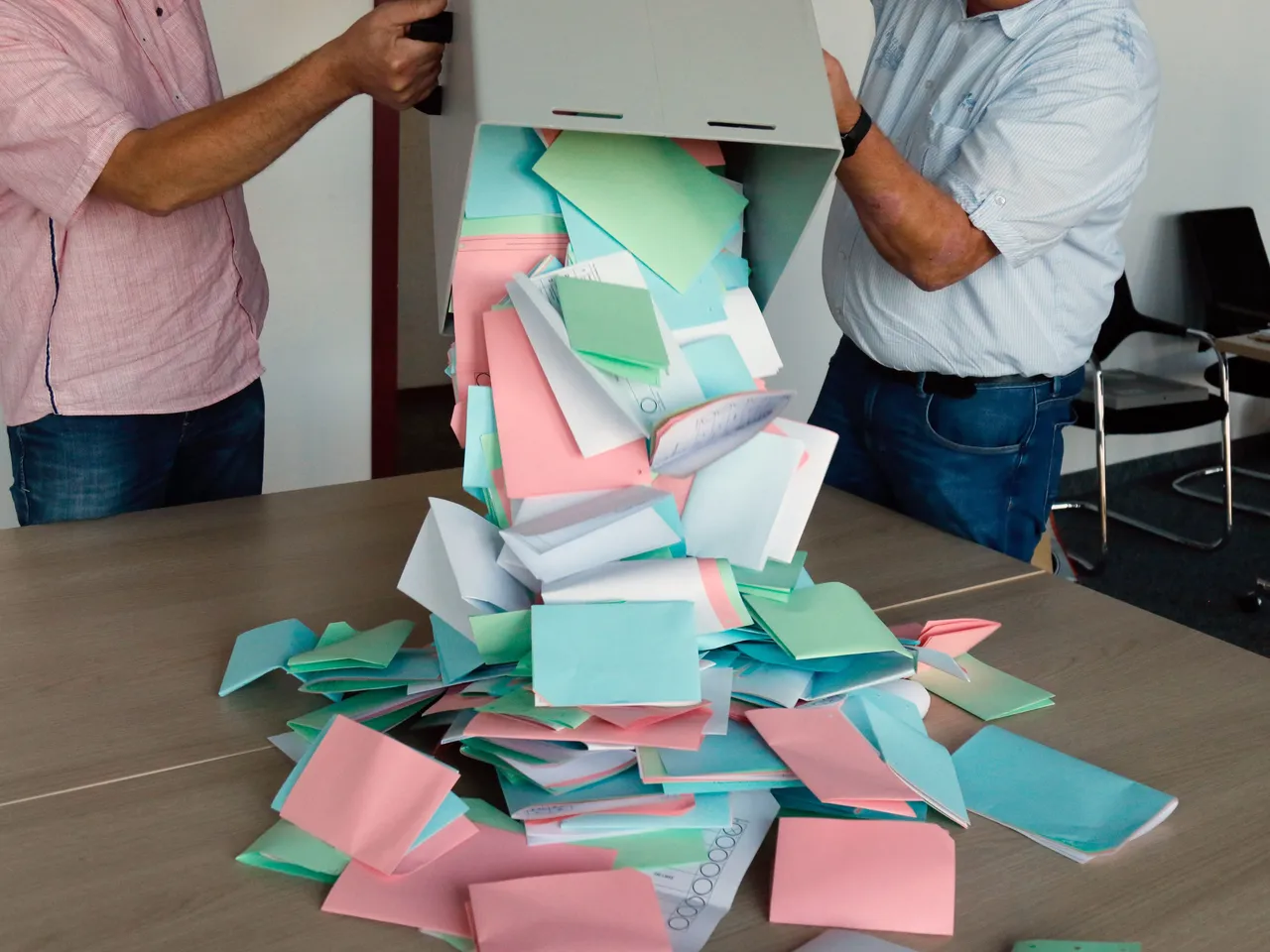Im großen Stil begehen ein oder mehrere unbekannte Täter Betrugsmaschen. Die Methode ist einfach: Im Internet werden private Verkaufsangebote gesucht. Bevorzugt iPhones und Smartphones. Der oder die Täter bestellen die Waren über einen Fakeaccount und lassen sie an einen falschen Namen an irgendeine Adresse liefern. Dabei drängen sie auf einen schnellen Versand, am liebsten per Express. Meist geben sie vor, die Sachen zeitnah verschenken zu wollen. Sobald die Bestellungen bei der genannten Adresse angekommen sind, herrscht Funkstille. Die Privatverkäufer bekommen weder ihr Geld, noch die Waren zurück.
Um diesen perfiden Plan ausführen zu können, benötigen die Täter Helfer, die ihre Wohnung als Lieferadresse zur Verfügung stellen.
Und so wird Anfang 2021 eine Zweifachmutter aus Lüdenscheid zur Helferin. Sie überklebt ihr eigenes Namensschild an der Klingel ihrer Wohnung mit dem Namen, der ihr von den Tätern genannt wird. Die Namen wechseln ab und zu. Im vorliegenden Fall nimmt die 27-Jährige elf Pakete an. Darin befinden sich überwiegend iPhones, die der oder die Täter für insgesamt 10971 Euro von Privatpersonen erworben, aber nie bezahlt hatten. Die Frau gibt die Pakete weiter. Sie soll für ihre Mithilfe entlohnt worden sein. Aus Sicht der Täter dumm gelaufen ist, dass es den ausgedachten Namen tatsächlich gibt. Dadurch waren die krummen Geschäfte letztlich auch ans Licht gekommen. Der wahre Namensträger war nämlich mit Zahlungsaufforderungen und Mahnungen überschüttet worden und zur Polizei gegangen. Die unter der angegebenen Adresse in Lüdenscheid gemeldete Frau fand sich wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug im Amtsgericht Lüdenscheid vor dem Strafrichter wieder.
Über ihren Verteidiger legte sie ein Geständnis ab. Was sie für ihre Unterstützung bekommen hatte, wollte sie allerdings nicht sagen. Ein 38-jähriger Bekannter der Frau teilte sich den Platz auf der Anklagebank mit ihr. Die Zweifachmutter gab an, der Mann habe sie zwar öfter besucht. Mit der Sache habe er aber nichts zu tun. Dem stimmte der Mitangeklagte zu. Da bei einer der Bestellungen Registrierungsdaten allerdings zum 38-Jährigen geführt hatten, sprach das Gericht den Mann nicht frei. Stattdessen stellte es sein Verfahren mit Blick auf eine Verurteilung zu 1300 Euro wegen Geldwäsche ein.
Die Frau brachte zwei Vorstrafen wegen Betruges und Diebstahls mit. Für sie endete der Prozess mit einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Will sie nicht ins Gefängnis, muss die Angeklagte für die Dauer von drei Jahren ein straffreies Leben führen und mit einem Bewährungshelfer zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird die Staatsanwaltschaft versuchen, die 10.971 Euro bei der Bürgergeldempfängerin einzuziehen. Der Richter beließ es trotz der hohen Schadenssumme bei einem Jahr und nicht mehr. Grund dafür war hauptsächlich das Geständnis, das dem Gericht eine lange und umfangreiche Beweisaufnahme ersparte.